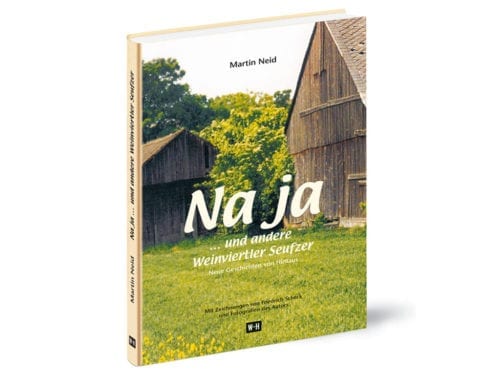Meeresstrand und Mammutwiese
Geologie und Paläontologie des Weinviertels
Von Thomas Hofmann, Mathias Harzhauser, Reinhard Roetzel
Format: 23,5 x 20 cm
Umfang: 138 Seiten mit zahlreichen Abbildungen
Einband: Hardcover
€ 21,90
Auf Lager
Beschreibung
Die Weite des Weinviertels birgt im Untergrund eine reiche geologische Vergangenheit. Ausgehend von 600 Millionen Jahren alten Graniten, auf denen die Retzer Windmühle steht, bis hin zur jüngsten geologischen Ablagerung, dem eiszeitlichen Löss, beschreiben die Autoren die Entstehung der Landschaft des Weinviertels.
Schicht für Schicht werden die kilometerdicken Ablagerungen der einstigen Meere für den Leser dokumentiert. Muscheln und Schnecken aus Sand- und Tongruben wie auch Weinkellern zeugen von tropischem Klima und Meeresverbindungen, die vom Weinviertel bis zum Indopazifik im Osten reichten. Sturmfluten und Tsunamis sind hier ebenso überliefert wie dunkle Tiefseeablagerungen.
Krokodile, das weltgrößte Austernriff bei Stetten, Seekühe und Delfine sind Zeugen des maritimen Weinviertels. Gigantische Hauerelefanten und riesige Mammuts waren in der geologischen Neuzeit am Land unterwegs. Neben der geologischen Entwicklung der Landschaft und der Geschichte der einstigen Lebewesen befassen sich eigene Kapitel mit angewandten Themen wie den Baugesteinen des Weinviertels, den Mineralwässern, den Erdöl- und Erdgasvorkommen, der „bewegten Erde“ sowie der Forschungsgeschichte von Geologie und Paläontologie der Region.
Zahlreiche Rekonstruktionen, paläogeografische Karten und Fossilbilder ergänzen dieses Werk, das die kaum beachtete Vielfalt des geologischen Untergrundes mit seinen Querverbindungen in den Alltag lebendig vor Augen führt.
Inhalt:
Seven Summits Geografische Höhe(n)punkte
Vom Granit zum Löss Eine Zeitreise quer durch 600 Millionen Jahre
Ein Blick in die steinernen Wurzeln Der Maissauer Amethyst und seine Entstehung
Die Retzer Windmühle in der Meeresgischt und Algenschnee vor Maissau Eggenburgium und Ottnangium: 21,5 bis 17,2 Millionen Jahre vor heute
Der verschwundene Strand von Göllersdorf und der Tsunami vom Teiritzberg Karpatium: 17,2 bis 15,9 Millionen Jahre vor heute
Der Canyon von Kettlasbrunn und der Moldavit von Immendorf Badenium: 15,9 bis 12,8 Millionen Jahre vor heute
Das Wattenmeer von Hollabrunn und „Abu Dhabi“ am Hendlfutterberg Sarmatium: 12,8 bis 11,6 Millionen Jahre vor heute
Die Ur-Donau von Mistelbach und die Dreizehen-Pferde vom Steinberg Im Pannonium: 11,6 bis 8 Millionen Jahre vor heute
Staubwein und das Mammut auf der Autobahn Pleistozän: 2,6 Millionen Jahre bis 11.700 Jahre vor heute
Baugesteine im Weinviertel Lokal bedeutende Vorkommen
Weinviertler Thermal- und Mineralwässer Wellness seit dem Biedermeier
Das „schwarze Gold“ Wie es wurde und wie es zu finden ist
Zistersdorf Übertief 2A Der übertiefe Vorstoß in den Untergrund
Bewegte Erde Von Beben, Störungen und Rutschungen
Forschungs- und Erfolgsgeschichten Johann Krahuletz und geologische Netzwerke
Autoren
Mathias Harzhauser, Paläontologe, Abteilungsdirektor der geologisch-paläontologischen Abteilung am Naturhistorischen Museum Wien.
Mag. Thomas Hofmann, Kindheit und Jugend in Wien und im Weinviertel. Studium der Erdwissenschaften an der Universität Wien, Leiter von Bibliothek, Verlag und Archiv der Geologischen Bundesanstalt. Zahlreiche (Buch-) Veröffentlichungen mit Schwerpunkt Weinviertel.
Reinhard Roetzel, Geologe, Leiter der Fachabteilung Sedimentgeologie an der Geologischen Bundesanstalt.
Michael Pfabigan in: Niederösterreichische Nachrichten
Thomas Hofmann und Reinhard Roetzel von der Geologischen Bundesanstalt haben gemeinsam mit dem Paläontologen Mathias Harzhauser vom Naturhistorischen Museum Wien die geologische Vergangenheit des Weinviertels aufgearbeitet.
Dr. Helga Maria Wolf in: Austria Forum
Das Weinviertel ist das geologisch am besten erforschte Gebiet Österreichs, schon im 19. Jahrhundert gab es Untersuchungen. In den 1990er Jahren war das Korneuburger Becken Ziel konzentrierter wissenschaftlicher Bearbeitungen. Ein internationales Team von 40 Experten konnte hier mehr als 650 fossile Tier- und Pflanzenarten – von winzigen Algen bis zu Nashörnern – nachweisen.
Johannes Gans in: Kultur und Wein
Die Winzer wissen schon, was sie dem Boden schuldig sind, wenn sie stolz auf die satte Mineralität des Lössbodens oder die feinen Fruchtnoten ihres Weins vom Urgestein sind. Dass es dazu kommen konnte, ist das Ergebnis einer sich über Milliarden von Jahren hinziehenden Entwicklung dieses so bukolischen Stücks Niederösterreich, das sich heute mit sanften Hügeln, weiten Feldern, Weingärten und freundlichen Ortschaften präsentiert. Spannend ist der Blick, wenn er von Wissenschaftlern darauf gelenkt wird. Thomas Hofmann, Mathias Harzhauser & Reinhard Roetzel geben uns eine Ahnung von diesen gewaltigen Ereignissen.
Tiroler Tageszeitung
Dafür erfährt man dann, dass es in der nun so sanften Hügellandschaft einst bis zu 600 Meter tiefe Canyons gab, früher dort Seekühe, Krallentieren und Dreizehen-Pferde grasten und man heute noch versuchen kann, sich den „Schnee“ von Algenblüten, der einst an der Küste des heutigen Maissau zum Meeresgrund rieselte, auf der Zunge zergehen zu lassen.
Richard Edl in: WeinviertelBücher
In den ersten beiden Kapiteln geben sie einen Überblick über die geologische Großlandschaft Weinviertel und deren Entwicklung. Die „Zeitreise quer durch 600 Millionen Jahre“ erklärt die Entstehung von Granit, dem ältesten Gestein, bis hin zum Löss, der landschaftsprägenden oberflächlichsten und jüngsten Formation. Die folgenden Kapitel widmen sich mehr oder weniger bekannten geologischen und paläontologischen Fundstellen wie dem Maissauer Amethyst, den berühmten Eggenburger Funden des Pioniers Krahuletz an den Ufern des Urmeeres Parathetys, dem Muschelberg von Nexing, der Austernbank vom Teiritzberg oder den Erdöllagerstätten des östlichen Weinviertels. Letztere bieten durch ihre intensive Beforschung mit Tiefbohrungen den Geologen besonders viel Informationsmaterial.
Günter Schweigert in: fossilien Erdgeschichte erleben
Vor einem Besuch des Weinviertels sei die Lektüre dieses hervorragend aufbereiteten und trotz vieler Fachbegriffe gut verständlichen Buchs wärmstens empfohlen. Auch in der dort ansässigen Bevölkerung dürfte wohl den wenigsten bekannt sein, welche erdgeschichtlichen Schätze dort schon gehoben wurden oder noch auf ihre Hebung warten.
Ferdinand Altmann in: Kulturnachrichten aus dem Weinviertel
Dass unser Weinviertel einst vor und für Jahrmillionen im Meer gelegen ist – lange bevor Menschen auf dieser Erde gelebt haben – erzählen Mathias Harzhauser, Thomas Hofmann und Reinhard Roetzel in ihrem neuen Buch „Meeresstrand und Mammutwiese“, das vor kurzem in der Edition Winkler-Hermaden erschienen ist.